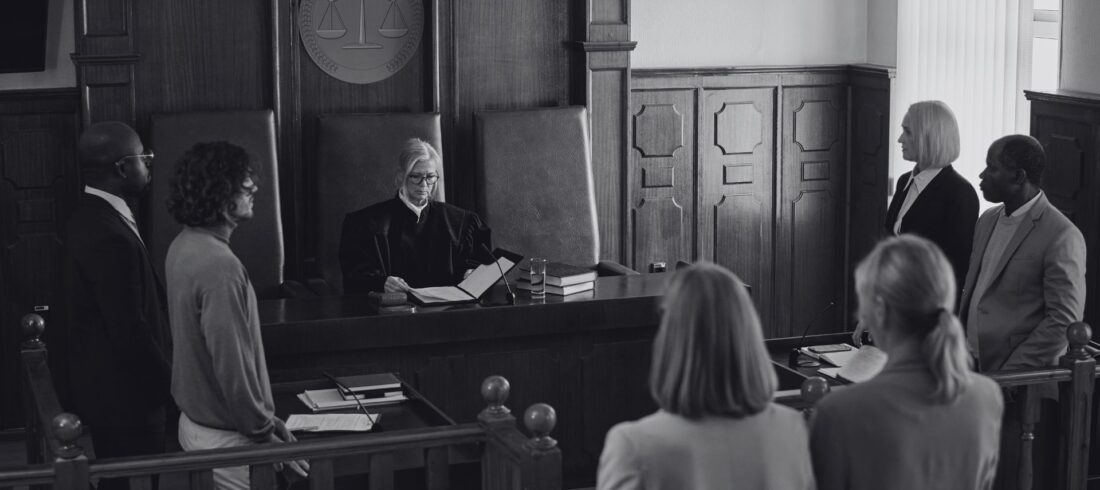OLG Dresden: Strenge Anforderungen an Verurteilungen in Sexualstrafverfahren – Wann Beweiswürdigung nicht ausreicht
Einleitung: Worum geht es in dieser Entscheidung?
Sexualstrafverfahren gehören zu den schwierigsten und sensibelsten Bereichen des Strafrechts. Häufig steht Aussage gegen Aussage – es gibt keine weiteren Zeugen, keine objektiven Beweise. In solchen Konstellationen müssen Gerichte besonders sorgfältig prüfen und ihre Überzeugungsbildung nachvollziehbar darlegen. Das Oberlandesgericht Dresden hat mit seinem Beschluss vom 15. Oktober 2024 (Az. 2 ORs 21 Ss 266/24) deutlich gemacht, welch strenge Anforderungen an die Beweiswürdigung in Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs gelten – insbesondere, wenn die Vorwürfe lange nach der Tat erhoben werden.
Diese Entscheidung im Strafrecht ist nicht nur für Betroffene von Sexualstrafverfahren relevant, sondern zeigt grundsätzlich auf, wann ein Urteil im Strafrecht wegen mangelhafter Begründung aufgehoben werden muss. Wenn Sie mit einem Strafverfahren konfrontiert sind oder Fragen zu einer strafrechtlichen Verurteilung haben, finden Sie auf www.rechtsanwalt-lott.de kompetente Beratung und Unterstützung.
Der Sachverhalt: Was war geschehen?
Ein Lehrer wurde beschuldigt, im Jahr 2016 zwei damals 14-jährige Schüler seiner Klasse sexuell missbraucht zu haben. Die Vorwürfe lauteten konkret:
Fall 1: Während eines Skilagers in Tschechien soll der Angeklagte einen Schüler, der wegen Beinschmerzen zu ihm kam, am Oberschenkel massiert haben. Anschließend habe er gefragt, woher das Testosteron komme, und dabei den nur mit Boxershorts bekleideten Jugendlichen unvermittelt an die Hoden gefasst und die nackte Haut berührt.
Fall 2: Bei einer Nachhilfestunde soll der Lehrer einen anderen Schüler zunächst über, dann unter dem Pullover massiert haben. Anschließend habe er seine Hand in die Unterhose des Schülers geführt – angeblich, um den Verlauf von Sehnen zu zeigen – und dabei die Innenseiten der Oberschenkel sowie mit dem Handrücken den Penis berührt.
Der entscheidende Punkt: Die Taten sollen Anfang 2016 stattgefunden haben, die Strafanzeige erfolgte aber erst im Dezember 2019 – mehr als dreieinhalb Jahre später. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe und machte von seinem Schweigerecht Gebrauch.
Das Amtsgericht verurteilte den Angeklagten zunächst zu einer Geldstrafe, sprach ihn aber in drei weiteren Fällen frei. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Das Landgericht Dresden verurteilte ihn daraufhin zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Gegen dieses Urteil im Strafrecht legte der Angeklagte Revision ein – mit Erfolg.
Die Entscheidung des OLG Dresden: Warum wurde das Urteil aufgehoben?
Das Oberlandesgericht Dresden hob die Verurteilung vollständig auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an eine andere Berufungskammer zurück. Der Beschluss im Strafrecht macht deutlich: Die Beweiswürdigung des Landgerichts genügte nicht den rechtlichen Anforderungen.
Aussage gegen Aussage: Besondere Darstellungspflichten
In Fällen, in denen die Überzeugung des Gerichts allein auf den Angaben von Geschädigten beruht und keine weiteren objektiven Beweise vorliegen, gelten besonders strenge Anforderungen. Das OLG stellte klar:
Die Aussagen müssen vollständig und geschlossen dargestellt werden. Das bedeutet: Nicht nur die Aussage in der aktuellen Hauptverhandlung muss im Urteil wiedergegeben werden, sondern auch alle früheren Aussagen – etwa bei der Polizei oder in vorherigen Gerichtsverhandlungen. Nur so kann das Revisionsgericht überprüfen, ob die Aussagen konstant geblieben sind oder ob es Widersprüche gibt.
Im vorliegenden Fall fehlte genau diese geschlossene Darstellung. Das Landgericht hatte zwar die Aussagen aus der aktuellen Hauptverhandlung und von den polizeilichen Vernehmungen dokumentiert, aber nicht dargestellt, was die beiden Geschädigten im ersten Rechtsgang vor dem Landgericht ausgesagt hatten. Bei einem Geschädigten fehlte diese Darstellung vollständig, beim anderen beschränkte sie sich auf eine einzige zeitliche Angabe.
Konstanzanalyse muss nachprüfbar sein
Gerichte prüfen regelmäßig die sogenannte Aussagekonstanz: Bleibt ein Zeuge bei seinen Angaben zum Kerngeschehen, oder gibt es Abweichungen? Kleinere Unterschiede bei Randdetails sind normal und sogar ein Indiz für Glaubwürdigkeit – auswendig gelernte Aussagen klingen oft verdächtig identisch. Aber bei wesentlichen Punkten muss das Gericht Abweichungen erkennen, bewerten und erklären.
Das OLG Dresden kritisierte: Ohne vollständige Darstellung aller Aussagen konnte das Revisionsgericht nicht überprüfen, ob das Landgericht eine fachgerechte Konstanzanalyse durchgeführt hatte. Diese Lücke in der Beweiswürdigung machte das Urteil im Strafrecht angreifbar.
Entstehungsgeschichte der Vorwürfe bei Sexualdelikten
Besonders bei Sexualstrafverfahren – und vor allem bei Vorwürfen gegen Minderjährige oder Jugendliche – muss das Gericht genau untersuchen und im Urteil erörtern, wie es zur Anzeigenerstattung kam:
- Wer hat wann erstmals von den Vorwürfen erfahren?
- Wie und unter welchen Umständen wurden die Vorwürfe kommuniziert?
- Gab es möglicherweise Beeinflussung oder Absprachen?
- Welche Motivation könnte hinter einer Falschbeschuldigung stehen?
Im vorliegenden Fall vergingen zwischen den angeblichen Taten Anfang 2016 und der Anzeige Ende 2019 mehr als dreieinhalb Jahre – ein erheblicher Zeitraum. Das OLG bemängelte, dass das Landgericht die Entstehungsgeschichte der Anzeige nicht ausreichend aufgeklärt und dargestellt hatte:
- Das Urteil erwähnte zwar, dass die Anzeige über die Mutter eines Geschädigten und den Schulförderverein erstattet wurde, teilte aber nicht mit, was in der Anzeige stand.
- Unklar blieb, wer wann welche Informationen an wen weitergegeben hatte.
- Auch die Aussage, die Geschädigten hätten sich schon früher Schulfreunden anvertraut, war nicht durch tatsächliche Grundlagen belegt.
Diese Lücken verhinderten eine umfassende revisionsrechtliche Überprüfung.
Verstoß gegen Verschlechterungsverbot
Das OLG stellte zudem fest, dass das Landgericht höhere Einzelstrafen und eine höhere Gesamtstrafe verhängt hatte als im ersten Rechtsgang. Dies verstößt gegen § 358 Abs. 2 Satz 1 StPO: Wenn nur der Angeklagte Rechtsmittel eingelegt hat, darf er durch die neue Entscheidung nicht schlechter gestellt werden als zuvor. Dieses sogenannte Verschlechterungsverbot ist ein wichtiger Schutz für Angeklagte im Strafverfahren.
Praktische Konsequenzen: Was bedeutet diese Entscheidung für Betroffene?
Dieser Beschluss im Strafrecht hat weitreichende Bedeutung für alle Beteiligten in Sexualstrafverfahren:
Für Beschuldigte und Angeklagte
Wenn Sie eines Sexualdelikts beschuldigt werden und die Anklage sich ausschließlich oder hauptsächlich auf Zeugenaussagen stützt, müssen die Gerichte besonders sorgfältig vorgehen. Achten Sie bzw. Ihr Verteidiger darauf, dass:
- Alle Aussagen vollständig protokolliert werden – nicht nur die aktuelle Hauptverhandlung, sondern auch frühere Vernehmungen.
- Die Entstehungsgeschichte der Vorwürfe aufgeklärt wird – besonders bei langen Zeiträumen zwischen Tat und Anzeige oder wenn Dritte (Eltern, Lehrer, Therapeuten) involviert waren.
- Widersprüche und Abweichungen thematisiert werden – auch scheinbar kleine Details können bedeutsam sein.
- Das Verschlechterungsverbot beachtet wird – wenn nur Sie Rechtsmittel eingelegt haben, darf die neue Strafe nicht höher ausfallen.
Ein erfahrener Strafverteidiger wird diese Punkte systematisch prüfen und in der Revision geltend machen, wenn das Gericht die Darstellungsanforderungen nicht erfüllt hat.
Für Geschädigte und Nebenkläger
Auch für Opfer sexueller Übergriffe ist diese Entscheidung relevant: Sie zeigt, wie wichtig detaillierte und konstante Aussagen sind. Das bedeutet nicht, dass Sie eine perfekt auswendig gelernte Geschichte erzählen müssen – im Gegenteil. Aber die wesentlichen Kernpunkte sollten in allen Vernehmungen erkennbar sein.
Bereiten Sie sich auf Fragen zur Entstehungsgeschichte vor: Wann haben Sie erstmals jemandem von dem Vorfall erzählt? Warum haben Sie erst später Anzeige erstattet? Solche Fragen dienen nicht der Diskreditierung, sondern sind rechtlich notwendig.
Für die Praxis in Strafverfahren generell
Die Entscheidung unterstreicht die hohen Anforderungen an die Begründungspflicht von Gerichten. Ein Urteil im Strafrecht muss so abgefasst sein, dass es von einem Revisionsgericht nachvollzogen und überprüft werden kann. Pauschale Würdigungen oder fehlende Darstellungen können zur Aufhebung führen – selbst wenn die Überzeugung des Gerichts im Kern zutreffend sein mag.
Fazit: Sorgfältige Beweiswürdigung ist im Strafrecht unverzichtbar
Der Beschluss des OLG Dresden vom 15. Oktober 2024 macht deutlich: In Sexualstrafverfahren mit Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen müssen Gerichte ihrer Darlegungs- und Begründungspflicht umfassend nachkommen. Die vollständige Wiedergabe aller Aussagen, eine nachvollziehbare Konstanzanalyse und die genaue Prüfung der Entstehungsgeschichte sind keine Formalien, sondern wesentliche Voraussetzungen für ein rechtsstaatliches Verfahren.
Diese hohen Anforderungen schützen sowohl Beschuldigte vor unberechtigten Verurteilungen als auch Geschädigte vor willkürlichen Freisprüchen. Sie sichern die Qualität der Rechtsprechung und ermöglichen eine wirksame revisionsrechtliche Kontrolle.
Auf www.rechtsanwalt-lott.de finden Sie kompetente Beratung und Vertretung in allen Fragen des Strafrechts – von der ersten Beschuldigung über das Ermittlungsverfahren bis zur Hauptverhandlung und gegebenenfalls zur Revision.
Jetzt beraten lassen
Sind Sie von einem Strafverfahren betroffen – als Beschuldigter, Angeklagter oder als Geschädigter bzw. Nebenkläger? Stehen Sie vor einer Verurteilung, die Sie für unrechtmäßig halten? Oder haben Fragen zur Beweiswürdigung in einem laufenden Verfahren?
Rechtsanwalt Lott steht Ihnen mit langjähriger Erfahrung im Strafrecht zur Seite. Vereinbaren Sie einen Termin für eine ausführliche Beratung:
Kontakt:
Rechtsanwalt Lott
Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf: www.rechtsanwalt-lott.de/kontakt
Zögern Sie nicht, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen – im Strafrecht können bereits frühe Weichenstellungen entscheidend sein.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Beschluss des OLG Dresden
Was ist eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation?
Von einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation spricht man, wenn in einem Strafverfahren keine objektiven Beweise wie Videoaufnahmen, DNA-Spuren oder andere Zeugen vorliegen, sondern lediglich die Aussage des Geschädigten der Einlassung oder dem Schweigen des Angeklagten gegenübersteht. In solchen Fällen kann das Gericht seine Überzeugung ausschließlich auf die Glaubhaftigkeit der Aussagen stützen. Gerade in Sexualstrafverfahren ist diese Situation häufig anzutreffen, da solche Taten typischerweise im Verborgenen stattfinden. Das Strafrecht stellt hier besonders hohe Anforderungen an die Beweiswürdigung: Das Gericht muss die Aussagen sehr genau prüfen, alle Einlassungen des Angeklagten berücksichtigen und seine Überzeugungsbildung im Urteil nachvollziehbar und lückenlos darlegen. Nur so kann das Revisionsgericht später überprüfen, ob die Beweiswürdigung rechtsfehlerfrei erfolgt ist.
Was bedeutet Konstanzanalyse bei Zeugenaussagen?
Die Konstanzanalyse ist ein wichtiges Instrument zur Glaubhaftigkeitsprüfung von Zeugenaussagen. Dabei vergleicht das Gericht verschiedene Aussagen, die der Zeuge zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht hat – etwa bei der polizeilichen Vernehmung, in einer richterlichen Vernehmung oder in der Hauptverhandlung. Geprüft wird, ob die Aussagen im Kern übereinstimmen oder ob es wesentliche Widersprüche gibt. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Kerngeschehen und peripheren Details: Während die zentralen Punkte konstant bleiben sollten, sind kleinere Abweichungen bei Randdetails normal und sogar ein Zeichen für Glaubwürdigkeit – auswendig gelernte Aussagen wirken oft verdächtig identisch. Das Gericht muss im Urteil darstellen, welche früheren Aussagen es geprüft hat, wo Übereinstimmungen und wo Abweichungen bestehen, und wie es diese bewertet hat. Nur eine vollständige Darstellung ermöglicht die revisionsrechtliche Kontrolle dieser Würdigung.
Warum ist die Entstehungsgeschichte der Vorwürfe so wichtig?
Die Entstehungsgeschichte beschreibt, wie es zur Erhebung der Vorwürfe und zur Anzeigenerstattung kam. In Sexualstrafverfahren – besonders bei Vorwürfen aus der Vergangenheit – muss das Gericht genau untersuchen: Wann und wem gegenüber hat der Geschädigte sich erstmals eröffnet? Gab es Gespräche mit Eltern, Therapeuten, Lehrern oder anderen Vertrauenspersonen? Wie lange liegt die angebliche Tat zurück? Welche Umstände führten zur Anzeigenerstattung? Diese Prüfung ist wichtig, um mögliche Beeinflussungen, Absprachen oder Motivationen für Falschbeschuldigungen auszuschließen. Bei jugendlichen oder kindlichen Zeugen kommt hinzu, dass diese besonders beeinflussbar sein können – durch suggestive Fragen, durch Erwartungshaltungen von Erwachsenen oder durch nachträgliche Informationen. Je länger der Zeitraum zwischen Tat und Anzeige, desto genauer muss die Entstehungsgeschichte aufgeklärt werden. Das Gericht muss diese Prüfung im Urteil dokumentieren und in die Gesamtwürdigung einbeziehen.
Was passiert, wenn ein Urteil aufgehoben wird?
Wenn ein Revisionsgericht ein Urteil aufhebt, bedeutet das nicht automatisch einen Freispruch. Vielmehr wird die Sache in der Regel an eine andere Kammer des erstinstanzlichen Gerichts zurückverwiesen – so auch im vorliegenden Fall. Dort muss das Verfahren komplett neu verhandelt werden. Die neue Kammer ist nicht an die Bewertungen der vorherigen Kammer gebunden und muss eine eigenständige Beweiswürdigung vornehmen. Die Zeugen werden erneut vernommen, alle Beweise neu erhoben und gewürdigt. Erst dann ergeht ein neues Urteil. Für den Angeklagten kann dies bedeuten, dass er erneut verurteilt wird – allerdings unter Beachtung der vom Revisionsgericht festgestellten Rechtsfehler. Es ist aber auch ein Freispruch möglich, wenn die neue Kammer zu einer anderen Bewertung gelangt. Die Aufhebung eines Urteils ist also zunächst ein verfahrensrechtlicher Schritt, der dem Angeklagten eine neue Chance gibt, aber keine abschließende Entscheidung in der Sache darstellt.
Was ist das Verschlechterungsverbot in der Revision?
Das Verschlechterungsverbot aus § 358 Abs. 2 Satz 1 StPO besagt: Wenn nur der Angeklagte Rechtsmittel gegen ein Urteil eingelegt hat, darf er durch die neue Entscheidung nicht schlechter gestellt werden, als er es durch das angefochtene Urteil war. Das bedeutet konkret: Die neue Strafe darf nicht höher sein als die ursprüngliche, und es dürfen keine zusätzlichen Nebenfolgen oder Maßregeln verhängt werden. Dieses Verbot schützt den Angeklagten davor, durch die Einlegung eines Rechtsmittels ein Risiko einzugehen, das seine Situation verschlechtert. Im vorliegenden Fall hatte nur der Angeklagte Revision eingelegt, das Landgericht hatte aber im zweiten Rechtsgang höhere Einzelstrafen und eine höhere Gesamtstrafe verhängt – ein klarer Verstoß gegen dieses Verbot. Das Verschlechterungsverbot gilt allerdings nur, wenn ausschließlich der Angeklagte Rechtsmittel eingelegt hat; hat auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, greift dieser Schutz nicht.
Wie lange dauern Strafverfahren in solchen Fällen üblicherweise?
Die Verfahrensdauer in Sexualstrafverfahren kann erheblich variieren. Im vorliegenden Fall zogen sich die Verfahren über mehrere Jahre hin: Die angeblichen Taten fanden Anfang 2016 statt, die Anzeige erfolgte Ende 2019, das erstinstanzliche Urteil erging im August 2022, das erste Berufungsurteil im Dezember 2022 wurde aufgehoben, das zweite Berufungsurteil erging im Januar 2024 und wurde nun erneut aufgehoben. Solche langen Verfahrensdauern sind in komplexen Strafverfahren mit mehreren Instanzen nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn Revisionen eingelegt werden und Urteile aufgehoben werden müssen. Jeder Verfahrensgang bedeutet neue Hauptverhandlungen, Zeugenvernehmungen und Beweisaufnahmen. Für alle Beteiligten – Angeklagte wie Geschädigte – ist dies eine erhebliche Belastung. Allerdings sind solch gründliche Prüfungen notwendig, um rechtsstaatliche Standards zu wahren und Fehlurteile zu vermeiden. Eine kompetente anwaltliche Vertretung kann helfen, Verfahren effizient zu gestalten und unnötige Verzögerungen zu vermeiden.
Kann man gegen jeden Beschluss oder jedes Urteil Revision einlegen?
Nein, nicht jede gerichtliche Entscheidung kann mit der Revision angefochten werden. Die Revision ist ein außerordentliches Rechtsmittel, das nur gegen Urteile der Strafkammern der Landgerichte und gegen Urteile der Oberlandesgerichte statthaft ist. Gegen Urteile der Amtsgerichte ist zunächst die Berufung zum Landgericht das richtige Rechtsmittel. Erst gegen das Berufungsurteil des Landgerichts kann dann Revision zum Oberlandesgericht oder zum Bundesgerichtshof eingelegt werden. Wichtig ist zudem: Die Revision prüft nur Rechtsfehler, keine Tatsachenfragen. Das Revisionsgericht überprüft also nicht, ob die Beweiswürdigung des Tatgerichts „richtig“ war, sondern nur, ob sie rechtsfehlerfrei erfolgte – etwa ob gegen Denkgesetze, Erfahrungssätze oder Verfahrensvorschriften verstoßen wurde. Die Revision muss fristgerecht innerhalb einer Woche nach Urteilsverkündung eingelegt und innerhalb eines Monats begründet werden. Diese Fristen sind zwingend und können nicht verlängert werden. Eine anwaltliche Vertretung durch einen in Revisionssachen erfahrenen Rechtsanwalt ist daher unerlässlich.
Welche Rolle spielt der Zeitablauf zwischen Tat und Anzeige?
Der zeitliche Abstand zwischen der angeblichen Tat und der Anzeigenerstattung ist ein wichtiger Faktor in der Beweiswürdigung, allerdings kein automatisches Kriterium gegen die Glaubwürdigkeit. Viele Opfer sexueller Übergriffe benötigen Zeit, bis sie über das Geschehene sprechen können – aus Scham, Angst, Verdrängung oder weil sie erst im Nachhinein verstehen, dass sie Opfer geworden sind. Das Strafrecht erkennt diese Realität an. Gleichzeitig verpflichtet ein längerer Zeitabstand das Gericht zu besonders sorgfältiger Prüfung: Wie hat sich die Erinnerung entwickelt? Gab es zwischenzeitlich Gespräche oder Therapien, die die Erinnerung beeinflusst haben könnten? Was war der konkrete Auslöser für die verspätete Anzeigenerstattung? Das Gericht muss diese Umstände im Urteil darlegen und würdigen. Im vorliegenden Fall lagen über dreieinhalb Jahre zwischen Tat und Anzeige – ein Umstand, der die Entstehungsgeschichte besonders bedeutsam machte. Das OLG bemängelte, dass gerade diese Fragen nicht ausreichend aufgeklärt worden waren.
Was kann ich tun, wenn ich fälschlicherweise eines Sexualdelikts beschuldigt werde?
Eine Beschuldigung wegen eines Sexualdelikts ist eine existenzielle Bedrohung und erfordert sofortiges und besonnenes Handeln. Zunächst gilt: Machen Sie keine übereilten Aussagen – weder gegenüber der Polizei noch gegenüber anderen Personen. Nutzen Sie Ihr Schweigerecht und wenden Sie sich umgehend an einen erfahrenen Strafverteidiger. Dieser wird die Vorwürfe analysieren, die Aktenlage prüfen und eine Verteidigungsstrategie entwickeln. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Anwalt gegenüber vollständig und wahrheitsgemäß schildern, was vorgefallen ist oder eben nicht vorgefallen ist. Ihr Anwalt unterliegt der Schweigepflicht und kann Sie nur optimal verteidigen, wenn er alle Fakten kennt. Sammeln Sie alle Beweise, die Ihre Unschuld belegen könnten: Alibis, Zeugen, Kommunikationsverläufe, Kalendereinträge. Im Verfahren wird es darauf ankommen, die Glaubwürdigkeit der belastenden Aussagen zu erschüttern – etwa durch Aufzeigen von Widersprüchen, ungeklärten Entstehungsgeschichten oder möglichen Falschbeschuldigungsmotiven. Ein erfahrener Verteidiger kennt die hohen Darstellungsanforderungen, die das OLG Dresden in seiner Entscheidung betont hat, und wird sicherstellen, dass diese im Verfahren beachtet werden.
Welche Bedeutung haben Aussagen von Kindern und Jugendlichen in Strafverfahren?
Kinder und Jugendliche können als Zeugen vernommen werden und ihre Aussagen haben grundsätzlich denselben Beweiswert wie die Aussagen von Erwachsenen. Allerdings sind bei der Bewertung ihrer Aussagen besondere Umstände zu berücksichtigen: Kinder und Jugendliche sind in höherem Maße suggestibel, das heißt, sie können durch die Art der Befragung, durch Erwartungshaltungen oder durch Informationen von außen beeinflusst werden. Ihre Erinnerungsfähigkeit entwickelt sich noch, und sie können Schwierigkeiten haben, zwischen tatsächlich Erlebtem, Geträumtem oder Erzähltem zu unterscheiden. Aus diesem Grund schreibt die Strafprozessordnung in solchen Fällen häufig die Hinzuziehung eines Sachverständigen vor, der die Aussagetüchtigkeit und Glaubhaftigkeit beurteilt. Bei der Vernehmung gelten besondere Schutzvorschriften: Kinder werden oft in speziell gestalteten Räumen und durch geschulte Personen befragt, teilweise per Videoübertragung, um eine Konfrontation mit dem Angeklagten zu vermeiden. Das OLG Dresden betont in seinem Beschluss, dass bei kindlichen und jugendlichen Zeugen in Missbrauchsfällen der Entstehungsgeschichte der Beschuldigung besondere Bedeutung zukommt – gerade weil diese Zeugengruppe besonders schutzbedürftig, aber auch besonders beeinflussbar ist.